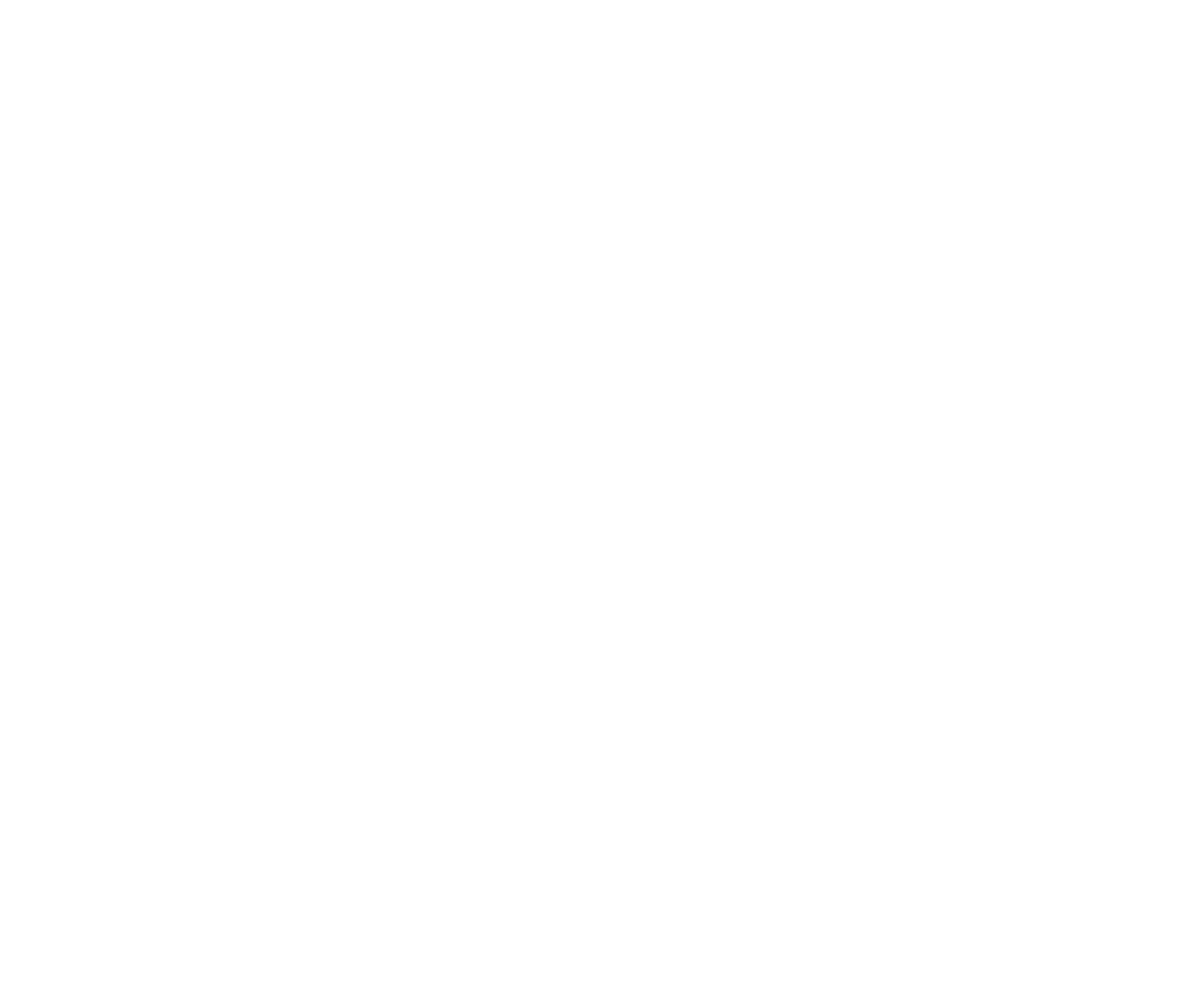Foto: Leipzig, Karl-Marx-Platz (heute Augustusplatz) – Demonstranten bei Montagsdemonstration am 16.10.1989, Fotograf: Friedrich Gahlbeck
Dankbarkeit, Demokratie und was das mit Corona zu tun hat
Inzwischen ist das neue Jahr schon ein paar Tage alt. Aber es fühlt sich so an, wie das vergangene Jahr. Außer, dass sich die letzte Zahl geändert hat und Januar ist. Immer der gleiche Trott. Früher hatte ich dem Jahreswechsel mehr Beachtung geschenkt. Ich hatte Erwartungen, Pläne, Vorsätze – das ist mir irgendwie abhanden gekommen und ich frage mich, ob es nur mir so geht.
von Heike
Früher gab es mehr Lametta! Früher gab es kein Corona. Früher war alles besser?
Wenn ich sage, dass ich mein Leben jetzt viel intensiver erlebe, als früher, ist das nicht gelogen.
Wegen Corona oder mit Corona?
Ich kann es gar nicht so genau sagen.
Vielleicht bin ich inzwischen auch verrückt geworden.
Ich bin aufgewachsen in einer Diktatur,
In der Schule sind wir fast alle brav gewesen,
Hin und wieder verschwanden auch Erwachsene.
Solche, die zur falschen Zeit am falschen Ort das vermeintlich Falsche gesagt haben. Sie wurden bei der Staatssicherheit verpfiffen, von „Freunden“, Kolleg*innen, von Verwandten. Der unsichtbare Feind war überall. Was in den Stasi-Gefängnissen in Stollberg, Hohenschönhausen oder Bautzen passierte, darüber kann man sich heute sehr ausgiebig informieren und ich empfehle den Personen, die Zweifel an unserer Geschichte hegen und meinen, in der DDR war doch alles gar nicht so schlimm, sich selbst ein Bild davon zu machen, unter welch unwürdigen Bedingungen Menschen weggesperrt wurden. Nur, weil sie das Land verlassen wollten oder nur, weil sie etwas gesagt haben, wofür sie von anderen verpetzt wurden.
Auch ich wurde kurz nach meinem 18. Geburtstag zu einem Gespräch gebeten, saß zwei „netten“ Herren in einem abgedunkelten Büro gegenüber und mir wurden bei Kaffee und Kuchen die beruflichen Vorteile aufgezählt, die ich hätte, wenn ich mich doch dazu entschließen könnte, in die Partei (die SED) einzutreten. Ich habe das dankend abgelehnt und habe das Büro schnellstens verlassen. Karriere mithilfe der Stasi? In der DDR? Darauf hab ich geschissen.
So einfach war das – man konnte auch Nein sagen!
Andere willigten ein, immer und immer wieder. Und übten Verrat an ihren Mitmenschen und denen, die sie liebten, der eigenen Karriere wegen (oder auch der ihrer Kinder) oder auch nur wegen vermeintlicher Anerkennungen in Form von Abzeichen oder einer extra Banane.
Wer auffällig wurde, wurde verwanzt. Die Stasi brach in Wohnungen ein, versteckte Wanzen, überall. Auch in den Schlafzimmern und Kinderzimmern. Und dann hockten sie offensichtlich irgendwo und ich will mir gar nicht vorstellen, was sie da getrieben haben, wenn sie mal wieder ein nächtliches Intermezzo von Ahnungslosen miterlebten.
Es gab sicherlich auch genügend Menschen, die von der Stasi erpresst wurden, die mit wirklich harten Konsequenzen rechnen mussten, wenn sie nicht mitarbeiteten. Denn die Stasi wusste alles. Man musste in einem solchen Fall zwangsweise mitmachen, weil vielleicht ein Unglück innerhalb der Familie passieren könnte. Wie viele zerbrachen daran?
Auch diese Menschen waren Opfer einer hässlichen Diktatur.
Die DDR erschien mir immer grau und dreckig. Kein Land, wo man freiwillig leben will. Der Traum, irgendwann in den Westen zu gehen, war täglich präsent und ich versuchte mir oft vorzustellen, wie es da wohl sein wird. Ich kannte ihn – den Westen – allerdings nur vom schlechten Empfang aus unserem Röhrenfernseher in Schwarz-Weiß, wenn wir alle zusammen um 20 Uhr bettfertig davor hockten und die Tagesschau glotzten. Ich erinnere mich an Hans Rosenthal und Harald Juhnke. An Sascha Hehn auf dem Traumschiff, den ich als Kind genauso anhimmelte, wie meine Mutter es tat. Ach, war das schön, wenn ich mich so wegbeamen konnte und mein Vater in völliger Inbrunst den „Rauchenden Colts“ entgegenfieberte. Ich glaube, das lief immer sonntags.
Wir hatten übrigens Bekannte, die im Konsum arbeiteten und von denen wir ab und zu mal etwas Besonderes zugesteckt bekamen, was wir in unserer kleinen Welt sonst nicht hatten. Und wir hatten West-Verwandtschaft, von denen wir in regelmäßigen Abständen Kehrpakete, zum Teil auch mit den abgetragenen Klamotten, erhielten. Die Pakete konnte die West-Verwandtschaft sogar von der Steuer absetzen, hatte ich dann später mal erfahren.
Meistens waren die Pakete unterwegs schon mal geöffnet worden. Wie Briefe auch. Sowas wie Privatsphäre gab es eben nicht.
Erwähnen möchte ich an der Stelle selbstverständlich auch noch die Wahlen, die zwangsweise alle vier Jahre stattfanden und bei der nur eine Partei zur Auswahl stand. Es waren immer die gleichen alten Verbrecher (hier brauche ich nicht zu gendern, denn das waren nur Männer), die an der Macht waren, an der Macht blieben und sich feierten. Dabei war es völlig egal, ob man den Stimmzettel ungültig machte oder gar nicht zur Wahl gegangen ist. Am Ende stand da 100 %. Wir wurden belogen, hintergangen und klein gehalten. All die mutigen Menschen, die sich gegen dieses abartige System stellten, die versuchten, auszubrechen, wurden weggesperrt, misshandelt und – wenn sie Glück hatten – wurden sie vom Westen freigekauft. Wie viele Eltern wurden ihrer Kinder beraubt, wie viele Familien getrennt? Das nennt man Leben in einer Diktatur.
Und dann kam die Wende.

Es begann mit vorsichtigen Treffen in den Kirchen (die waren irgendwie tabu für die Stasi), dann gingen wir auf die Straßen. Zuerst sind wir nur wenige gewesen. Doch es schlossen sich immer mehr an. Wieder ständig die Angst im Nacken, denn die bewaffneten Kampftruppen waren präsent und unübersehbar. Nur am Anfang gab es Ärger und es wurden erste Demonstrant*innen zurückgeprügelt und bedrängt. Am Ende liefen die Kameraden (ich gendere hier auch nicht, denn es gab da nur Männer) der Kampftruppen zusammen mit uns Demonstrant*innen. Auch die Polizei schloss sich uns an. Wir riefen gemeinsam „Wir sind das Volk“ und „Freiheit“ und es war ein so unbeschreibliches Gefühl, als erste Menschen über die Grenze in das geheiligte Land gelangten. Gänsehaut, ein Sieg, eine friedliche Revolution. Endlich frei. Ich mittendrin.
Tausende DDR-Bürger passierten mit ihrem PKW den Grenzübergang Zarrentin im Bezirk Schwerin.
Trotz zügiger Abfertigung kam es hier zeitweise zu Staus bis zu 2 Kilometern.
Ich war damals 20 Jahre, hatte bereits eine einjährige Tochter und weinte vor Glückseligkeit, als mir klar wurde, dass mein Kind in einem freien Land aufwachsen würde.
Doch es war schwer. Als alleinerziehende junge Mutter hatte ich es in der DDR schon nicht leicht, in dem neuen Leben schon gar nicht. Ich musste kämpfen, mich behaupten und lernen, mich durchzusetzen. Oft stand ich ohnmächtig und kraftlos vor Entscheidungen, denen ich nicht gewachsen war. Aber ich war frei. Auch wenn der Preis hoch war.
Ich hatte das große Glück, dass ich mich von Niederlagen nie lange beeindrucken ließ und genug Kraft hatte, wieder aufzustehen. Ich wusste, es geht immer weiter, denn ich musste keine Angst mehr davor haben, dass ich irgendwie wieder beobachtet werde. Mein Leben liegt einzig und allein in meiner Hand. Das ist ein Privileg der Freiheit und der Demokratie. Dafür bin ich unglaublich dankbar.
Warum ich das erzähle? Weil ich jetzt wieder Angst habe.
Angst, dass die alte Zeit wiederkommt. Angst vor diesen Leuten, die jetzt schreien „Wir sind das Volk“. Sie haben uns dieser Worte von damals bestohlen. Das waren die Worte einer friedlichen Revolution.
Dieses Mal habe ich keine Gänsehaut, wenn ich sie brüllen höre. Ich sehe unsere Demokratie und unseren Frieden in Gefahr. Unsere Freiheit, weil sich etwas breit macht, was nicht nur mich sprachlos macht. Und irgendwie hilflos.
Ich gebe zu, Corona macht etwas mit uns. Am Anfang sah es doch noch so aus, als ob wir alle zusammenhalten. Dass wir das gemeinsam durchstehen. Das hatte etwas von Stärke und gutem Charakter. Doch als ich das erste Mal Security vor den Eingängen der Supermärkte sah, hatte ich ein beklemmendes Gefühl und konnte nicht glauben, dass das geschieht. Und das nur, weil vereinzelte Personen sich nicht an absolut notwendige Vorgaben halten wollten („Ich lasse mir doch nichts vorschreiben“). Es mussten plötzlich – für mich gefährlich aussehende – Menschen, andere darauf hinweisen, Abstand zu halten und einen Einkaufswagen zu benutzen, was sogar zu einzelnen Rangeleien führte.
Mich irritierten auch solche Hinweise, wie „Wascht euch die Hände!“ Was? Das tut man doch immer, oder nicht? Gibt es Leute, die sich nicht die Hände waschen? Igitt.
Dinge, die für mich selbstverständlich und logisch waren, hielten andere für Gängelei und Freiheitsberaubung. Hilfe – wir leben in einer Diktatur!
Was ist los?
Wir erleben einen Ausnahmezustand, weit weg von einer Diktatur. Es nennt sich Pandemie. Das ist etwas besonders Bedrohliches, etwas, was unser Leben aus dem Gleichgewicht geworfen hat. Unser aller Leben. Da müssen wir zusammenhalten und alles dafür tun, dass alle geschützt sind. Wir müssen doch unsere Schutzmäntel ausbreiten und niemanden in Gefahr bringen. Logisch, dass das mit Einschränkungen zu tun hat. Aber diese nehme ich gerne in Kauf, wenn ich ein kleines bisschen dazu beitragen kann, dass diese Bestie Corona damit besiegt wird.
Leute – sagt mal, warum folgt ihr dubiosen Aufrufen von Menschen, von denen ihr nichts wisst? Prüft ihr vorher nicht, wem ihr euch anschließt? Was soll diese Anmaßung, zu sagen, dass wir in einer Diktatur leben? Lebten wir tatsächlich in einer Diktatur, so würdet ihr schon alle im Gefängnis sitzen oder Schlimmeres. Geht ihr auf die Straße, angestachelt von Leuten, die ganz sicher nichts Gutes im Sinn haben, weil der vermeintlich schlimme Staat von uns so etwas wie Mitgefühl und Nächstenliebe erwartet? Zutiefst verwurzelte menschliche Eigenschaften, die verloren gehen, wenn Herzensdummheit sich breit macht?
Ich muss zugeben, Corona macht in der Hinsicht einen guten Job. Es hat uns wachgerüttelt und herausgeworfen, aus unserem schönen, beschaulichen Leben.
Corona hält uns den Spiegel vor.
Corona macht mich demütig, gegenüber den Menschen, die unermüdlich im Einsatz sind und helfen. Die in dieser Zeit an ihre Grenzen kommen, darüber hinaus gehen und trotzdem nicht klagen. Demut vor denen, die vorm Bankrott stehen, aber trotzdem aufstehen und es dann doch schaffen, irgendwie weiterzukommen und nicht mit auf die Straße gehen und sich dann lauthals den Frust von der Seele schreien.
Mir ist klar, dass nicht alle Menschen in der Lage sind, stark zu sein. Corona fordert heftige Opfer.
Es ist für viele so schwer, das ist mir absolut bewusst.
Es ist nun einmal eine Pandemie. Gerade deswegen sollten wir doch zusammenhalten. Das Prinzip Nächstenliebe ausleben – wir sollten füreinander da sein und den Schwachen helfen. Das nennt sich Menschlichkeit.
Wie die allermeisten in diesem Land, habe ich ein Dach überm Kopf, muss nicht hungern und kann hingehen, wohin ich möchte. Wenn ich gegen die Regierung demonstrieren möchte, mache ich das und muss mit keinen Konsequenzen rechnen. Ich darf frei meine Meinung äußern und hab Zugang zur ganzen Welt. Ich habe Vertrauen. Dass ich eine Diktatur überlebt habe und in einem freien Land leben darf – dafür bin ich dankbar. Gerade in dieser Zeit ist dieses Bewusstsein so präsent und darum kann ich tatsächlich behaupten, ich lebe noch viel intensiver, als vor Corona.
Und ich werde alles dafür tun, dass dieses Land frei bleibt.
Corona wird bald Geschichte sein. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass spätestens dann die Menschen wieder zueinander finden. Ich glaube daran. Warum? Weil ich Hoffnung habe.
„Man sollte wissen, dass die Freiheit ungeheuer verletzlich ist.“ (Fritz Stern – Historiker)