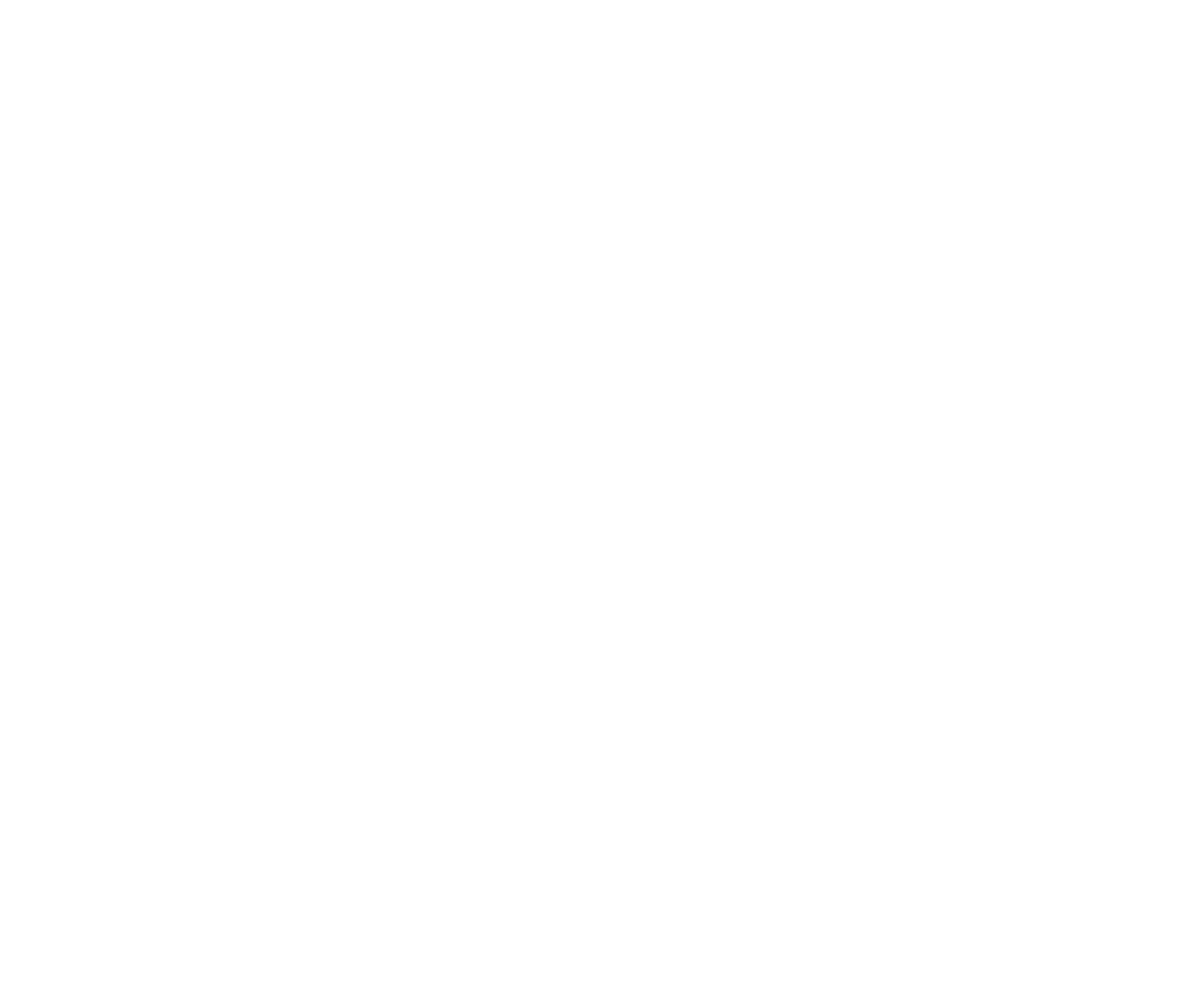von Ole Krüger
Ole wurde 1983 in der ehemaligen DDR geboren. Seine Jugend verbrachte er in den 90er Jahren in Ludwigslust während der „Baseballschlägerjahre“. Seit 2003 lebt er in Rostock, wo er Germanistik und Neuere Geschichte studierte. Seit 2011 ist er Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen und seit 2020 Landesvorsitzender. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die ungleichen Lebensverhältnisse in Ost und West und deren Überwindung.
Nicht erst seit den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen befinden sich die ostdeutschen Bundesländer auf einem politischen Sonderweg. Und inzwischen fragt sich ganz Deutschland, warum „der Osten“ so anders wählt. Liegt es an der DDR? Liegt es an der Art und Weise der Wiedervereinigung? Der Blogbeitrag geht diesen Fragen nach und wagt einen „Osten“, der gar nicht so trist und einfach ist, wie er oft dargestellt wird.
Ost und West sind sich eigentlich gar nicht mehr so fremd
35 Jahre nach der Wiedervereinigung sind die „neuen Bundesländer“ so neu nicht mehr. Sie sind zu einem selbstverständlichen Teil der Bundesrepublik Deutschland geworden. Die subjektive Lebenszufriedenheit hat sich zwischen den beiden ehemals getrennten Teilen Deutschlands angenähert, die große Kluft bei der Arbeitslosigkeit hat sich verringert und im vergangenen Jahr ist die Wirtschaft in Ostdeutschland sogar um 0,7 Prozent gewachsen, während sie bundesweit um 0,3 Prozent schrumpfte[1].
Die Ansiedlungen von Tesla in Brandenburg und Intel in Sachsen-Anhalt, aber auch die vollen Auftragsbücher der Werften in Mecklenburg-Vorpommern lassen hoffen, dass sich auch die Produktivitätslücke schließen könnte. Nicht zuletzt der Ausbau der erneuerbaren Energien im östlichen Landesteil erhöht die Attraktivität für weitere Industrie- und Gewerbeansiedlungen. Seit 2017 ziehen mehr Menschen nach Ostdeutschland als in umgekehrter Richtung abwandern. Darunter sind viele „Rückkehrer*innen“ in der eigenen „Familienplanungsphase“ (zwischen 30 und 49 Jahren), die aus beruflichen Gründen in den „Westen“ gegangen sind und nun zunehmend auch in der Nähe ihrer (Groß-)Eltern passende Arbeitsplätze finden.[2]
Nach mehr als drei Jahrzehnten haben sich die beiden deutschen Gesellschaften nicht nur kennen gelernt, sondern sind eng miteinander verwoben: Am Arbeitsplatz, im Freundeskreis und häufig auch in Paarbeziehungen, in denen sich beide Elternteile der Erziehung der gemeinsamen Kinder widmen. Insgesamt 26% der deutschen Bevölkerung haben einen „Ost-Hintergrund“, sind also selbst im Osten geboren oder haben zumindest einen Elternteil mit einer „DDR-Sozialisation“. Trotz aller Fortschritte ist der Beziehungsstatus zwischen West- und Ostdeutschland nach wie vor „kompliziert“.
[1] Ostdeutschland schiebt die Wirtschaft in Deutschland an | ZDFheute
[2] Binnenmigration in Deutschland 1991-2022 | Deutschland | bpb.de
Der Blick auf den „Osten“ ist Teil des Problems
Einer der Gründe liegt in der allgemeinen gesamtdeutschen Sicht auf „den Osten“. Man kann die umstrittene These von Dirk Oschmann, „der Osten“ sei eine bloße Erfindung „des Westens“, getrost zurückweisen.[1] Die gesamtdeutschen Medien berichten über Ost-Themen oft nur dann, wenn es um Rechtsextremismus, Wirtschafts- oder Infrastrukturschwäche geht. Damit prägen sie natürlich auch die (soziale, wirtschaftliche und politische) Selbstwahrnehmung der Ostdeutschen. Zudem gibt es (abgesehen von einzelnen Publikationen wie „SUPERillu“ oder dem „Mitteldeutschen Rundfunk“) keinen öffentlichen Raum, den die Ostdeutschen „für sich haben“, um die eigene DDR-Geschichte oder auch die Umbruchs- und Transformationszeit der 90er Jahre für sich „aufzuarbeiten“.
Die „Westdeutschen“ und ihr Blick auf den Osten sitzen immer mit am gesellschaftlichen „Verhandlungstisch“. Und diese westdeutsche „Brille“ sieht oft so: Der Osten hat die Segnungen des Westens „geschenkt“ bekommen. Mit der Übernahme der freien Marktwirtschaft und des Parteiensystems der Bonner Republik sei es nur eine Frage der Zeit, bis sich ein ähnliches Wirtschaftswachstum einstellt und sich auch das Wahlverhalten an der Urne angleicht. Wer so auf Ostdeutschland blickt, wundert sich dann natürlich, wenn Massenarbeitslosigkeit entsteht, rechtsextreme Gewalttaten zunehmen und rechtsextreme wie populistische Parteien Wahlerfolge feiern. Die einzige Erklärung, die dann – mehr oder weniger offen – zwischen den Zeitungszeilen und Fernsehmoderationen übrig bleibt, ist die Erzählung von den „demokratieunfähigen/diktaturgeschädigten“ Ostdeutschen, die unser politisches Parteiensystem nicht verstehen und/oder die Chancen der freien Marktwirtschaft nicht zu nutzen wissen. So treffend diese Berichterstattung an der wirtschaftlichen und politischen Realität der ostdeutschen Bürger*innen vorbeigeht, so wenig können sie sich in dieser „Erzählung über den Osten“ wiederfinden. Und da diese „Erzählung über den Osten“ auch die Äußerungen bundespolitischer Spitzenpolitiker*innen prägt, kann sich natürlich auch kein Gefühl des „Gehörtwerdens/Vertretenwerdens“ bei den Ostdeutschen einstellen, ebenso wenig wie das Vertrauen, dass „die da oben“ die richtigen politischen Weichenstellungen vornehmen. Der bundespolitische Diskurs geht an den Menschen vorbei.
Die Räume, die durch dieses „aneinander vorbeireden“ entstehen, werden insbesondere von der AfD, aber auch vom BSW besetzt. Der „Osten“ fühlt sich nicht verstanden und Höcke, aber auch Wagenknecht bestärken ihn in dieser – leider richtigen – Wahrnehmung. Um zu verstehen, warum dieser Punkt so zentral ist, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass die „Wende“ in den Augen der westdeutschen Mehrheitsgesellschaft ein abgeschlossener Prozess ist, ein abgeschlossenes Kapitel im deutschen Geschichtsbuch, während sie für die ostdeutsche Minderheitsgesellschaft ein noch andauernder Prozess ist. Während der westliche Teil des Landes sich „aussuchen“ kann, ob und wann er sich mit der deutsch-deutschen Vergangenheit auseinandersetzt, ist der östliche Teil des Landes tagtäglich damit konfrontiert, beruflich, privat und politisch. Dies erklärt auch den Erfolg antidemokratischer Parteien an den ostdeutschen Wahlurnen. Gerade in Krisenzeiten ist das Bedürfnis nach gesamtdeutscher, bundespolitischer Wahrnehmung besonders groß. Die Menschen wollen dann aber auch „richtig“ wahrgenommen werden. Das heißt, sich und ihre Probleme im öffentlichen Diskurs wiedererkennen. Stimmt der gesamtdeutsche „Blick“ nicht, dann droht mit jedem öffentlichen Diskurs über Ostdeutschland das Gefühl der Entfremdung zu wachsen.
[1] Prof. Dr. Dirk Oschmann: „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung: Wie die Konstruktion des Ostens unsere Gesellschaft spaltet“ (Ullstein)
Auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung sind beide Bevölkerungsteile noch nicht auf Augenhöhe, zumindest was die Aufarbeitung der gemeinsamen deutsch-deutschen Geschichte und Gegenwart betrifft. Es bedarf einer grundsätzlichen, kontinuierlichen Beschäftigung mit dem Osten. Nicht nur dann, wenn Wahlen anstehen und antidemokratische Parteien in den Umfragen hoch stehen. Sondern aus einem Diskurs „über die Ostdeutschen“ muss ein Diskurs „mit den Ostdeutschen“ werden.
Ole Krüger
Ostdeutsche sitzen oft nicht mit am gesellschaftlichen Tisch
Im Zuge der Wiedervereinigung kam es zu einem historisch beispiellosen Austausch gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Eliten. Universitätsprofessuren, Theaterintendanzen, Richterposten, Unternehmensvorstände und zahlreiche andere gesellschaftliche „Verantwortungspositionen“ wurden in den damals neuen Bundesländern mit Westdeutschen besetzt, die dafür nicht selten eine sogenannte „Buschzulage“ erhielten. Die Hoffnung, dass mit der Zeit Ostdeutsche (wie von selbst) in diese Positionen nachwachsen würden, hat sich nicht erfüllt. Eliten rekrutieren ihren Nachwuchs aus den eigenen Reihen. Ostdeutsche verfügen häufig nicht über die Netzwerke bzw. den Zugang zu Netzwerken, um bei der Besetzung von Positionen im eigenen Bundesland berücksichtigt zu werden. D.h. viele gesellschaftlich relevante Ämter und Positionen werden nicht nur auf Bundesebene, sondern bereits in den ostdeutschen Bundesländern von Personen ohne „Osthintergrund“ besetzt.
„Demokratische Teilhabe und Mitgestaltung ist ja nicht allein auf Wahlen beschränkt. Sie betrifft ja auch die Besetzung von Spitzenpositionen in Wirtschaft, Medien, Justiz, Gewerkschaften, zivilgesellschaftlichen Organisationen et cetera. Die nicht gefühlte Teilhabe führt zur Distanz zum System. Man glaubt einfach nicht mehr, dass man mitgestalten kann, wenn man sieht, die eigene Gruppe hat nicht die gleichen Chancen. Wer sich vom System abwendet, kann sich radikalisieren.“
– Dr. Lars Vogel (Elitenforscher Universität Leipzig)
„Die da oben“ und „wir hier unten“ werden so als alltägliche Gegensätze verfestigt. Besonders deutlich wird dies beim Blick auf die Herkunft der ostdeutschen Landesregierungen. 2020 kamen gerade einmal 50% der Kabinettsmitglieder in den ostdeutschen Bundesländern (Berlin ausgenommen) aus Ostdeutschland. Ein Wert, der seit 1990 noch nie so niedrig war. Das ist der niedrigste Wert seit 1990. Ein Grund dafür ist bereits in den ostdeutschen Parteien zu finden. In 40 Jahren DDR, in denen die Parteimitgliedschaft in der SED oder den DDR-Blockparteien eher als „zwangsweise Notwendigkeit“ wahrgenommen wurde, haben die ehemaligen DDR-Bürger*innen geradezu eine Abscheu gegen die Mitgliedschaft in Massenorganisationen entwickelt. Noch heute ist die Zahl der Partei- und Gewerkschaftsmitglieder deutlich geringer als in der ehemaligen „Bonner Republik“. Zum Vergleich: Weniger als 1% der Wahlberechtigten in Ostdeutschland sind Mitglied einer Partei. Die Rekrutierungsmöglichkeiten für „Spitzenpersonal“ sind daher nur halb so groß wie im Westen. Im Jahr 2021 hatten die im Bundestag vertretenen Parteien in Mecklenburg-Vorpommern zusammen nur 13.517 Mitglieder … bei rund 1,5 Millionen Einwohner*innen. Im vergleichsweise kleinen Saarland mit rund 1 Mio. Einwohner*innen waren es allein bei der SPD 14.716 Mitglieder. Die mangelnde gesellschaftliche Verankerung der Parteien wirkt sich im Osten natürlich auch auf das Wahlverhalten aus. „Die Wählerinnen und Wähler sind keine Stammkunden mehr, sondern allenfalls Schnäppchenjäger, die bei jeder günstigen Gelegenheit woanders fündig werden.“[1]
Die Erklärung dafür liegt in den Erfahrungen mit Parteien in der DDR. Damals wurde das parteipolitische Engagement von vielen Bürger*innen als Gängelung wahrgenommen. Zwar gab es neben der SED auch andere Parteien, aber diese „Blockparteien“ hatten kaum politische Selbständigkeit. Ein echtes Wechselspiel zwischen Regierungspartei und Opposition, wie es für die Bonner Republik charakteristisch war, war aus Angst vor einer „Konterrevolution“ verfassungsrechtlich unmöglich. Der einzige Raum, wo freie politische Diskussion möglich und erfahrbar war, war der private Raum im engsten Freundes- und Familienkreis. (Abgesehen von den Kirchenräumen zum Ende der DDR.) Der erste freie Volkskammerwahl, war zugleich die Letzte. Sie war damals weniger eine politische Willensbekundung für die DDR, als eine für die deutsche Einheit und somit gegen sie. „In diesem Bild übernehmen die Bundesrepublik und ihr Spitzenpersonal die Rolle der Konkursverwalter, die Ostdeutschen sind die bedürftigen Empfänger von Hilfe und Zuwendung, die selbst nur noch begrenzte Entscheidungsmacht ausüben.“[2] Waren die Ostdeutschen an den „Runden Tischen“ noch politische Subjekte, die mit den Vertreter*innen des damaligen SED-Parteiapparates eigenständig und eigenverantwortlich verhandelten, wurden sie mit der deutschen Einheit zu Objekten über deren Köpfe hinweg verhandelt wurden. Aus der Selbstermächtigung ist eine Entmachtung geworden.
Es ist nicht zuletzt diese fehlende gesamtgesellschaftliche Repräsentanz ostdeutscher Lebenserfahrungen, die rechtsextremistische und populistische Politiker*innen ausnutzen, um das Bild eines fremdbestimmten, kolonialisierten Ostdeutschlands zu zeichnen und gegen aktuelle politische Kompromisse zu instrumentalisieren. („Dafür sind wir 1990 nicht auf die Straße gegangen!“).
[1] Siehe Steffen Mau Seite, 106
[2] Siehe Steffen Mau, Seite 40
Literaturtipps:
- Steffen Mau: Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt.
Suhrkamp | 2024 | (ISBN: 978-3-518-02989-3)
- Ilko-Sascha Kowalczuk: Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde.
C. H. Beck Verlag | 2019 | (ISBN: 978-3-406-74020-6)
- Stefan Wolle: Die heile Welt der Diktatur: Alltag und Herrschaft in der DDR 1971–1989
Ch. Links Verlag | 2013 | (ISBN: 3-89331-349-4)
„Einheit“ ist ohne fairen Wettbewerb nicht möglich
Die Volkskammerwahl 1990 und der damalige Wahlsieg der „Allianz für Deutschland“ war ein klares Votum der DDR-Bevölkerung für Reisefreiheit, freie Wahlen und Meinungsfreiheit. Es war aber auch ein Votum gegen die damals herrschende Mangelwirtschaft. Das Versprechen des damaligen Bundeskanzlers Helmuth Kohl, bald „blühende Landschaften“ zu sehen, weckte die Erwartung einer Wiederholung des Bonner Wirtschaftswunders der 50er Jahre. Während damals im Westen ein „Marshallplan“ den wirtschaftlichen Aufschwung förderte, kam es im Osten zu einer von der „Treuhand“ gesteuerten flächendeckenden Deindustrialisierung mit Massenarbeitslosigkeit, beruflichem Abstieg und wirtschaftlicher Unsicherheit.
Mit gravierenden Folgen für die Gesellschaft: Abwanderung, sprunghaft ansteigende Scheidungsraten bei gleichzeitigem Geburtenrückgang um 50 %. Die Bilder der 35.000 Werftarbeiter, die in Rostock für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstrierten, haben sich damals ebenso wenig in das kollektive Gedächtnis Gesamtdeutschlands eingebrannt wie die Bilder der hungerstreikenden Bergarbeiter im Kaliwerk Bischofferode. Was blieb, war der Eindruck, dass es „denen da drüben“ und „denen da oben“ eigentlich egal ist, wie es ihren ostdeutschen Mitbürger*innen geht.
Bis heute sind diese traumatischen Transformationserfahrungen Teil jeder ostdeutschen Familie, während sie im Bewusstsein der westdeutschen Familien nie wirklich angekommen sind. Die 90er Jahre haben die ostdeutsche Gesellschaft, ja jede Familie in „Wendegewinner“ und „Wendeverlierer“ gespalten. Selbst diejenigen, die heute in relativem Wohlstand leben, haben die prägende Erfahrung gemacht, dass ihr privater Wohlstand etwas Fragiles ist, das jederzeit über Nacht verschwinden kann. Wo das westdeutsche Wirtschaftswunder Erfolgsgeschichten und eine stabile Mittelschicht hervorbrachte, hat sich Ostdeutschland von einer Industriegesellschaft zu einer Arbeitnehmergesellschaft gewandelt. Durchschnittlich niedrigere Einkommen (mit Ausnahme der Eliten) und kaum vorhandenes privates Vermögen stellen die Menschen nicht nur bei der eigenen Altersvorsorge vor Herausforderungen, sondern lösen bei jeder gesamtwirtschaftlichen Krisenstimmung Unsicherheiten aus und wecken negative Erinnerungen an die Wendezeit. Noch 2017 war das durchschnittliche Nettovermögen in Westdeutschland mit 121.500 Euro mehr als doppelt so hoch wie in Ostdeutschland mit 54.900 Euro .[1] Die harte wirtschaftliche Realität in Ostdeutschland wurde und wird von Rechtsextremen und Populisten gezielt aufgegriffen, um Neiddebatten zu schüren. Das „Wirtschaftswunder Ost“ ist nicht nur für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse zwischen West und Ost unverzichtbar, sondern auch das größte gebrochene Wahlversprechen, das den Ostdeutschen zu Beginn ihrer demokratischen Erfahrung gegeben wurde.
[1] Vermögen in West- und Ostdeutschland nach Alter | Die soziale Situation in Deutschland | bpb.de
Wir müssen „den Osten“ als eigenen politischen Raum verstehen
Die fehlende gesamtgesellschaftliche Repräsentanz und die harte ökonomische Realität in Ostdeutschland reichen als Erklärung für die Wahlerfolge antidemokratischer Parteien nicht aus. Vielmehr machen AfD und BSW ein tiefer liegendes Angebot, indem sie historisch gewachsene Stimmungen in der ostdeutschen Bevölkerung aufgreifen und zu ihren Gunsten verstärken. Sie schließen damit eine Kommunikationslücke zwischen den „etablierten (West-)Parteien“ und der Bevölkerung und schaffen es, sich als ostdeutsche Interessenvertretung auf dem Parteienmarkt zu inszenieren. Eine Rolle und Funktion, die früher die PDS bzw. DIE LINKE innehatte und nun verloren hat.
Sie betreiben und transportieren gezielt eine „ostdeutsche Identitätspolitik“, die den Westen als „entdeutscht“ und durch eine „Woke-Politik“ ruiniert darstellt. Sie schüren Ängste vor Überfremdung in einer „Multi-Kulti“-Gesellschaft und inszenieren Ostdeutschland als den Teil des Landes, der vor dieser Entwicklung bewahrt werden muss. Gleichzeitig setzen sie die heutige Bundesregierung mit dem Zentralkomitee der SED gleich und propagieren einen Demokratiebegriff, der ein vermeintlich natürliches Volksempfinden artikuliert und damit eine plurale Gesellschaft negiert, in der unterschiedliche legitime Interessen ausbalanciert werden müssen. Der politische Kompromiss wird zum Verrat an der „schweigenden Mehrheit“ stilisiert. Im Klartext: Das Demokratieverständnis der AfD ist nichts anderes als eine Diktatur der Mehrheit. Und was die Mehrheit will, wird natürlich allein von ihr bestimmt. Insofern ist das Demokratieverständnis der AfD identisch mit dem der SED. Insofern ist es auch nichts anderes als ein raffiniertes Versteckspiel“, wenn sie ihre Beobachtung durch den Verfassungsschutz in geschichtsverfälschender Weise mit der Beobachtung von DDR-Bürgerrechtlern durch das Ministerium für Staatssicherheit der DDR gleichsetzt. Mit diesem verzerrten „Versteckspiel“ immunisieren sie sich nicht nur gegen Kritik aus dem demokratischen Lager, sondern stellen sich auch in eine Reihe mit der DDR-Bürgerrechtsbewegung, auf die viele Ostdeutsche mit Stolz zurückblicken. Damit stellen sie einen Bezug her, den andere Parteien leider nicht herstellen, obwohl sie viel stärker in der damaligen Demokratiebewegung verwurzelt sind als die erst Jahrzehnte später gegründete AfD. Es ist bezeichnend für die ostdeutsche Repräsentationslücke, dass die noch lebenden DDR-Bürgerrechtler*innen es nicht schaffen, sich dieser Vereinnahmung zu widersetzen.
Die AfD knüpft zudem bewusst an fremdenfeindliche Einstellungen an, die es schon zu DDR-Zeiten gab, und spricht gerade die Bevölkerung in ländlichen Räumen an, die keinen Anschluss an die akademischen Diskussionen in den Cafés der Universitätsstädte hat. Gekonnt spielen sie mit dem Gefühl der ostdeutschen Bürger*innen, Bürger*innen zweiter Klasse zu sein, die von „denen da oben“ vernachlässigt werden. Gerade in Krisenzeiten, in denen die Sehnsucht nach Sicherheit, Stabilität und Zugehörigkeit wächst, bieten sie eine „Heimat“, in der sich die Menschen verstanden und in ihrer politischen und wirtschaftlichen Ohnmacht bestätigt fühlen. Wer in der Krise steckt – real oder nur gefühlt – erwartet mit innerer Dringlichkeit, dass seine Probleme gelöst werden. Für intellektuellen politischen Schlagabtausch oder parteistrategische Personaldebatten bleibt dann keine Wertschätzung übrig. Sie verstärken nur die innere Unruhe. Demokratiefeindliche Parteien können dann das Wesen der repräsentativen Demokratie als Schwäche oder gar Dysfunktionalität darstellen.
Menschen mit geringem Einkommen, insbesondere in strukturschwachen ländlichen Regionen, haben kaum Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht. Wer den Wandel nicht aktiv mitgestalten konnte und kann, lehnt Veränderungen eher ab. Auch und gerade dann, wenn eine große Transformationserfahrung bereits gemacht, in Ostdeutschland muss man oft sagen, überlebt wurde. Populisten/Rechtsextreme fordern nicht die Anpassung der Menschen an eine sich verändernde Welt. Sie fordern eine Anpassung der Welt an das „Ruhebedürfnis“ der Menschen. Es ist Aufgabe der demokratischen Parteien, den notwendigen Wandel nicht als notwendiges Übel, sondern als Aufbruch in eine bessere Zukunft zu vermitteln.
Die „Deutsche Einheit“ ist kein Zustand, sie ist ein Prozess
Mit Blick auf die ostdeutschen Kommunal- und Landtagswahlen, aber auch auf die Ergebnisse der Bundestags- und Europawahlen in Ostdeutschland stehen alle demokratischen Parteien vor der Herausforderung, einen Umgang mit rechtsextremen und populistischen Parteien zu finden. Vor allem die „Brandmauer gegen Rechts“ wird immer wieder beschworen und in Frage gestellt. Ganz so, als ob ein Blick zurück in die „Weimarer Republik“ diese Frage nicht beantworten würde. Im Großen und Ganzen verfolgt insbesondere die AfD die gleiche Strategie der Machtergreifung wie damals die Nationalsozialisten. Dieser Rückgriff ist durchaus legitim, denn Rechtsextremismus und Rechtspopulismus sind kein rein ostdeutsches Problem. Ostdeutschland steht diesbezüglich nur deshalb besonders im Fokus, weil die Wahlergebnisse dort deutlich höher sind als auf dem Gebiet der ehemaligen „Bonner Republik“. Doch auch dort gibt es wirtschaftlich schwache Regionen, in denen sich der wirtschaftliche Abschwung deutlich im Alltag der Menschen niederschlägt und auch dort stehen Kommunen und Bürger*innen vor der Frage, wie die gesellschaftliche Integration von Zugewanderten (auf dem Arbeitsmarkt, in den Schulen, in unserer Gesellschaft generell) gelingen kann.
Mit Blick auf Ostdeutschland steht die Politik aber in der Pflicht, alle falschen Weichenstellungen, die im überhasteten Vereinigungsprozess vorgenommen wurden, zu korrigieren. Nach mehr als drei Jahrzehnten darf sich niemand mehr der Illusion hingeben, es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West von selbst einstellen. Ihre Herstellung ist vielmehr als ein politisch zu steuernder Prozess zu verstehen, für den alle demokratischen Parteien Verantwortung übernehmen müssen. Nur in einem gesamtgesellschaftlichen Prozess kann eine Angleichung und ein gemeinsames „Auf Augenhöhe“ erreicht werden.
Die „Deutsche Einheit“ liegt im Interesse aller demokratischen Parteien und ist damit das perfekte Lehrstück, um konkret zu zeigen, dass Politik gemeinsam etwas für die Menschen bewegen kann. Das heißt konkret:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung sind beide Bevölkerungsteile noch nicht auf Augenhöhe, zumindest was die Aufarbeitung der gemeinsamen deutsch-deutschen Geschichte und Gegenwart betrifft. Es bedarf einer grundsätzlichen, kontinuierlichen Beschäftigung mit dem Osten. Nicht nur dann, wenn Wahlen anstehen und antidemokratische Parteien in den Umfragen hoch stehen. Sondern aus einem Diskurs „über die Ostdeutschen“ muss ein Diskurs „mit den Ostdeutschen“ werden.
Ole Krüger
Dass sich in den alten Bundesländern antidemokratische Kräfte etablieren konnten, ist eine Folge der mangelnden Etablierung demokratischer Institutionen und der unzureichenden Ermöglichung wirtschaftlicher, sozialer und politischer Teilhabe. Dies sind Grundvoraussetzungen, um sich als gleichberechtigter Teil der Gesellschaft verstehen zu können. Der Blick auf 40 Jahre DDR greift zu kurz. Vielmehr müssen wir die Wendezeit aufarbeiten und kritisch hinterfragen, ob Teilhabe und Chancengerechtigkeit zwischen West und Ost verwirklicht wurden. Erst dann können wir verstehen, warum die antidemokratischen Narrative von AfD und BSW in Ostdeutschland so gut verfangen.
Ostdeutsche sind keine Antidemokraten. Sie bekennen sich zu den freiheitlichen Grundwerten und sind auch bereit, diese zu verteidigen, wie die Demonstrationen für Demokratie Anfang des Jahres gezeigt haben. Aber wenn echte Teilhabe im Alltag nicht gelebt wird, dann nutzen Antidemokraten das aus und füllen die Lücke zwischen Anspruch und gelebter Wirklichkeit mit ihren verfassungsfeindlichen Narrativen. Welche bessere Antwort können wir ihnen geben, als gemeinsam weiter an der inneren Einheit zu bauen?